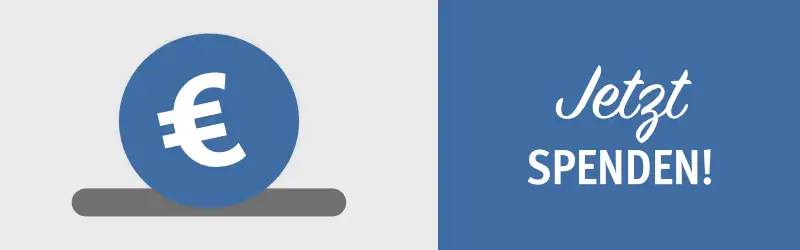17.06.2010
Predigt von Professor Dr. Volker Leppin im Wartburg-Gottesdienst am 4. Mai 2010
über Lukas 2,41-52
Da sitzt ein Mann allein an seinem Tisch, ringt mit dem Text, den er im Ohr hat, genau so und doch anders, ringt um die Übersetzung der Bibel, schreibt und arbeitet, arbeitet und schreibt, zwischen aller Übersetzungsarbeit Auslegungen, Briefe, Stellungnahmen. So kennen wir Martin Luther als rastlosen Arbeiter auf der Wartburg, wie er für die neuen Aufgaben umsetzt, was ihm aus seiner Laufbahn mitgegeben ist: das Erbe seiner Bildung.
Es ist die Bildung des Klosters, die Bildung der Gelehrten, die er mit Philipp Melanchthon teilt, seinem Gefährten in Wittenberg. In Erinnerung an seinen 450. Todestag hat die Evangelische Kirche in Deutschland das Jahr 2010 zum Jahr der Bildung bestimmt – und erinnert damit daran, dass die Reformation auch eine große Bildungsbewegung war. Christliche Bildung, die sich selbst vergisst, wenn sie nicht mehr sein will als das Erlernen von Tatsachen. Bildung, die einen ganzen Entwicklungsprozess mit sich bringt, wie wir ihn an Kindern beobachten können. An ihnen sieht man, wie sie sich entwickeln: wie sie zunächst, Jahr für Jahr, nur hören und aufnehmen. Wie sie dann fragen, das berühmte „Warum“, mit dem sie alles wissen wollen. Wie sie sich einordnen in den Wissenskosmos der Eltern, sich an deren Gewohnheiten gewöhnen – bis sie irgendwann daraus ausbrechen, die alten Zöpfe langweilig finden, sie abschneiden und Neues erleben wollen.
Die Lernentwicklung von Kindern ist vielfach erlebt, erzählt und analysiert, sie spiegelt sich auch in dem heutigen Predigttext. Er steht im Lukasevangelium im 2. Kapitel:
Lukas 2,41-52
„Nach der Gewohnheit des Festes“ zogen die Eltern nach Jerusalem und erlebten dort ganz und gar Ungewohntes. Denn die Durchbrechungen des Hergebrachten sind hier noch viel radikaler als wir es sonst so kennen.
Man fragt sich ja, wie all das überhaupt geschehen konnte. So sorglos wie Maria und Josef gehen heute Eltern mit ihren Kindern jedenfalls nicht mehr um, so geborgen ist unsere Welt nicht mehr: Einen ganzen Tag kriegt diese Zimmermannsfamilie aus Nazareth nicht mit, was mit dem kleinen Jesus ist, einen ganzen Tag denken sie, dass er sich wohl mit Freunden amüsiert, dass Bekannte schon ein Auge auf ihn werfen werden – eine ganze Tagesreise dauert es, bis sie ihn vermissen, dann machen sie sich auf, suchen nach ihm, und man kann erahnen, wie nun plötzlich die Sorgen aufkommen: ein Kind unter Freunden, im großen pilgernden Pulk, das ist gewiss behütet – aber ganz allein. Der Weg von Jerusalem nach Norden ist unwegsam, voller Gefahren, die klimatischen Bedingungen sind hart. Da kann man sich kaum vorstellen, dass ein Kind allein gut durchkommt. Und in Jerusalem selbst? Das ist damals schon die heilige Stadt zugleich und, jedenfalls für die Verhältnisse in der Region, die Großstadt. Auch da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihm etwas passiert größer als die, dass er heil und ungeschoren davon kommt. Welche Hetze auf dem Weg zurück, welche Sorge in Jerusalem, und dann sitzt er da, der kleine Lehrer zwischen den großen.
Ihm ist es gelungen, alles umzukehren, was sonst üblich ist, es neu zu formen, zu reformieren, und noch der Bericht des Lukas, der all dies erzählt, atmet etwas von dieser Umkehr: Erst ist es Jesus, der zuhört und fragt - und dann staunen die Schriftgelehrten über seine Antworten. Auf allen Ebenen also: Jesus, der weiterbringt, der durch seine Fragen Perspektiven eröffnet, mit denen niemand gerechnet hat, und Antworten dafür parat hat, auf die niemand sonst gekommen wäre. Da durchbricht er alle Schemata, die die Schriftgelehrten kennen. Sie sind es eigentlich, die das Wissen verwalten, und sie sind es auch, die fragen. Sie fragen sehr verschieden: Manchmal um den Bibeltext besser zu verstehen, weil sich in ihrer Umwelt ein Problem auftut, das sich nicht ohne Weiteres mit dem hergebrachten Wissen bewältigen lässt. Aber wenn sie Kinder vor sich haben, dann fragen sie nicht nur, um weiterzukommen, sondern sie wollen den Kindern helfen, auf diese Weise ihr Wissen zu erweitern und zu vertiefen. Sie fragen nach, fragen ab. Das Wissen, das erfragt wird, ist definiert, es ist bis zu einem gewissen Grad immer schon bekannt. So ist es klassisch bei Gelehrten, bei Lehrern, in der Schule.
Aber so richtig spannend wird es eben erst, wenn sich auch der Lehrer darauf einlässt, dass das Wissen nicht definiert, nicht immer schon bekannt ist, dass vielleicht das Kind mit seinen wachen, unverstellten Augen etwas entdeckt, was jahrhundertealte Traditionen der Wissensvermittlung nicht kannten. Es gibt berühmte Geschichten von solchem unverkrampften Blick der Kinder, Geniegeschichten meist. Etwa von dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß: ein aufgewecktes, manchmal wohl auch aufdringliches Kind, das sein Lehrer ruhig stellen wollte: Er solle mal die Zahlen von 1 bis hundert zusammenrechnen. Damit wäre er, so die Hoffnung des Lehrers, ein Weilchen beschäftigt, aber er schaffte es in Sekunden, indem er die Zahlen paarweise einander zuordnete, die eins und die hundert, die zwei und die 99 und so weiter, bis er nur noch fünfzig mal 101 rechnen musste. Ein Geniestreich, der Lehrer ins Schwitzen bringen kann.
Diese Lehrer in Jerusalem kommen wohl auch ins Schwitzen, staunen auch über den Verstand des Jungen – und merken doch nach und nach, dass es da um mehr geht als um einen hyperbegabten Geniestreich. Da übernimmt ein Kind einfach ihre Aufgabe: zu verkündigen, Gottes Willen mit dieser Welt mitzuteilen. Ohne gelehrtes Wissen und doch wissend und weise: Es ist nicht die Tradition der Generationen, die aus ihm spricht, aber etwas, was sie, die Lehrer, nur als „Verstand“ einordnen können. Man erfährt nicht, was er wohl gesagt hat, aber das Zusammenspiel von Fragen und Antworten, es kann nicht einfach das Kleinklein der Erklärung gewesen sein, es geht um die neue Perspektive, die in diesem Jungen, in Jesus-Christus selbst ihr Ziel hat. Das merken die Lehrer, und doch merken sie es noch nicht, jedenfalls nicht ganz, nicht umfassend, nicht so, wie man es merken könnte oder sollte. Aber in gewisser Weise richten sie sich schon danach, lassen ihn den Lehrer sein, werden selbst zu Schülern, stellen das Wissen hintan, damit dieser neue, unverkrampfte Blick wirken kann: ein Blick, der nur von Gott herkommt, nur auf ihn hinblickt.
Da ist schon ungeheuer viel Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, sich neu formen, sich irritieren zu lassen – wohl die erste Voraussetzung, um überhaupt offen für Gott zu sein: Wer nur in der Gewohnheit bleibt, der auch die Eltern zu Beginn dieser kleinen Geschichte mit ihrer Festgestaltung folgten, wird sich fragen müssen, ob er in dieser Gewohnheit eigentlich mehr erreicht als die Wiederholung des immer Gleichen , ob er wirklich Gott erreicht, genauer gesagt: ob wirklich Gott ihn erreicht. Diese Wege des Pilgerns, die Maria und Josef nachvollzogen, sie sind so wichtig wie die Gottesdienste, die wir feiern. Sie erinnern, mitten im Alltag, an Gott, aber je mehr sie wiederholt werden, je mehr sie zur Gewohnheit werden, um so mehr wird diese Alltagsdurchbrechung selbst wieder ein Alltag, zäh und bitter, gewohnt und so wenig befreiend. Ein ungewohntes Wort, ein ungewohnter Blick, der einem begegnet – so etwas kann noch einmal in ganz neuer Weise daran erinnern, dass es wirklich Gott ist, der Weihnachten zu uns kam, der uns in dieser Welt nicht alleinlässt.
Aber Irritationen können eben auch schwierig sein, nicht jeder setzt sich ihnen gerne aus – Maria und Josef gehören wie so viele Elternwohl eher zu denen, die sich nicht so gern irritieren lassen, schon gar nicht von ihrem Sohn: Derselbe Sohn, der eben die Lehrsituation im Tempel komplett umgekehrt hat, wird nun erzieherisch gerüffelt und gemaßregelt. Wer könnte es den Eltern auch verdenken: Sie machen sich die ganze Zeit Sorgen – und bei dem Sohn nichts dergleichen: Er sitzt einfach friedlich da, als wäre nichts. Wie wenig Rücksicht auf die Eltern, wie wenig Bereitschaft, sich in ihre Sorgen hineinzudenken – und welche Frechheit, dass er ihnen überhaupt diese Sorgen bereitet hat. Und sie erinnern ihn ja auch noch daran, wollen deutlich machen, worum es ihnen zu tun ist: „Mein Sohn, warum hast du uns das getan?“ fragt die besorgte Mutter. Was erwartet man da? Doch wohl, dass man in den Arm genommen wird, dass das Kind mit einem weint. Aber nichts dergleichen: „Was ist’s, dass ihr mich gesucht habt? Wisset ich nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist?“
Liebe Gemeinde, frech ist ja eigentlich gar kein Ausdruck für diese Antwort: Kein Mitleid mit den klagenden Eltern, sondern im Gegenteil: eine Umkehr des Vorwurfs: „Ihr braucht mich nicht zu suchen!“ und dann setzt er noch eines drauf, stellt seinen himmlischen Vater in Konkurrenz zu seinem irdischen. Da kriegen wir vielleicht auch eine kleine Ahnung davon, wie das Gespräch zuvor mit den Gelehrten abgelaufen ist, wie es Jesus möglich wurde, Perspektiven umzukehren: so einfach, so schlagend: Wer wollte schon bestreiten, dass der himmlische Vater unendlich viel wichtiger ist als der irdische? Da werden die menschlichen Regeln außer Kraft gesetzt, und eigentlich muss jeder zustimmen, dass das zu Recht geschieht. Aber der Aha-Effekt, den offenbar die Lehrer am Tempel verspürt haben, funktioniert bei den eigenen Eltern nicht. Wie sollte er auch? Welcher Vater mag so etwas schon gerne von seinem Sohn, seiner Tochter hören?
Da reagieren die Eltern lieber, wie so mancher, wenn er etwas hört, was ihm nicht passt: Sie verstehen lieber nicht, was der Junge sagt – es zu verstehen, wäre vielleicht zu schmerzlich für sie. Sie kehren in die Gewohnheit zurück, packen Sack und Pack und Sohn und kehren heim. Und damit könnte diese kleine Geschichte auch zu Ende sein, eine Geschichte von einem fehlgeschlagenen Gespräch zwischen Sohn und Eltern, wie sie manchmal in diesem Alter vorkommt. Man könnte die Achseln zucken und sagen: Naja, ist eben ein schwieriges Alter, schwierig vor allem für die Eltern.
Wenn da nicht ein Hinweis käme, dass sein Wort doch irgendwie gewirkt hat: nicht so plötzlich, nicht so schlagartig wie bei den Lehrern am Tempel, aber langsam, still und leise: So kann Gottes Wort auch einmal wirken: Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Da waren schon andere Worte, die sie dort behielt: die Worte der Hirten. Da ist es: ein Aufblitzen, ein Erkennen, ein Weiterdenken und –fühlen. Jesu Worte kommen an, nach und nach. Sie kommen im Herzen Mariens an – und sie sind angekommen, wenn es ihnen gelingt, die Perspektive auf all das, was uns umgibt, zu ändern, in unsere kleine Menschenperspektive hinein auch Gottes Perspektive zuzulassen. Und wenn diese Perspektive eröffnet wird, dann fängt Bildung an, dann wächst der Mensch, entwickelt sich, von Gott her und zu Gott hin – und damit letztlich zu sich selbst.
Dass Gott uns die Augen dafür öffne, dass wir in einer Welt leben, die von ihm erschaffen ist und von ihm erlöst wird, dazu verhelfe uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen
Volker Leppin ist Professor für Kirchengeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.