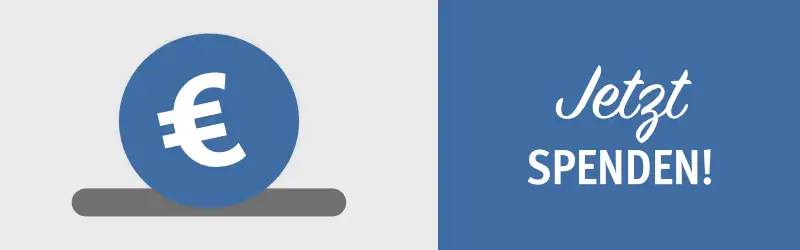25.10.2010
Predigt von Altbischof Dr. Christoph Kähler am 24. Oktober 2010 in der Georgenkirche
im Kantatengottesdienst über Johannes 4,47-54
Und es war ein Mann im Dienst des Königs;
dessen Sohn lag krank in Kapernaum.
47 Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam,
und ging hin zu ihm und bat ihn,
herabzukommen und seinem Sohn zu helfen;
denn der war todkrank.
48 Und Jesus sprach zu ihm:
Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.
49 Der Mann sprach zu ihm:
Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt!
50 Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt!
Der Mensch glaubte dem Wort,
das Jesus zu ihm sagte, und ging hin.
51 Und während er hinabging,
begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt.
52 Da erforschte er von ihnen die Stunde,
in der es besser mit ihm geworden war.
Und sie antworteten ihm:
Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber.
53 Da merkte der Vater, dass es die Stunde war,
in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt.
Und er glaubte mit seinem ganzen Hause.
54 Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat,
als er aus Judäa nach Galiläa kam.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde in St. Georgen!
„Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille;
wie er fängt seine Sachen an,
will ich ihm halten stille.“
Wer darf das eigentlich sagen? Wer so singen?
Der Chor wird mit dieser Strophe bald die Kantate beginnen.
Wir werden als Gemeinde mit weiteren Strophen dieses Liedes auf das Gottvertrauen der Kantate und die Wunder-, die Glaubensgeschichte aus dem Johannesevangelium antworten. Denn auch Johann Sebastian Bach bezog sich in seiner Kantate mittelbar auf diese Heilungsgeschichte
aus dem vierten Kapitel des Johannesevangeliums. So weit, so gut – in diesem Gottesdienst, an diesem Sonntag.
Aber auf einem Krankenbett, wenn wir starke Schmerzen haben und noch mehr zu befürchten ist, im Alltag, wenn Misserfolge und Unglück uns plagen,
im Streit, wenn Verbindungen und Verpflichtungen plötzlich nichts mehr wert sind, wird man dann singen und sagen: „Was Gott tut, das ist wohlgetan“?
Ja, doch, es gibt die Geheilten, die für ihre wiedererlangte Gesundheit danken dürfen. Es gibt die Eltern, die nicht aufgeben, die sich hartnäckig an jedes Hoffnungszeichen klammern, und alles für ihre Kinder tun, wie in der Geschichte der Beamte aus Kapernaum. Sie halten an ihrer Hoffnung gegen allen Zweifel fest. Und es gibt die Angehörigen, die dann aufatmen dürfen,
weil sie ein Kind in den Arm schließen, das wieder gesund geworden ist.
Wir alle haben uns über die geglückte Rettung der chilenischen Kumpel vor anderthalb Wochen gefreut. Eindrücklich wie der Onkel eines Geretteten sagte: „Die Erde wird 33 Lebewesen gebären. Heute ist die Fruchtblase geplatzt, und in wenigen Tagen wird die Geburt stattfinden. Mutter Erde wird uns 33 Menschen schenken.“ (FAZ 13.10. S.7)
Andere sprachen von Wiedergeburt und einem zweiten Leben. Eingeprägt hat sich mir vor allem das Bild eines Geretteten, der einfach still auf die Knie sank und für sich ein Gebet sprach, sehr eindrücklich.
Wer so etwas erlebt oder miterlebt, wird seinem Gefühl Luft schaffen, er dankt und lobt. Er fasst sein Glück in Worte, in Gebete, und sei es in den Psalm von Samuel Rodigast. Er spricht aus, was seine Seele bewegt:
„Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille;
wie er fängt seine Sachen an,
will ich ihm halten stille.“
Die Beobachter des Geschehens in Chile waren tief beeindruckt. Denn die so lange Eingeschlossenen konnten untereinander Disziplin wahren, also gewissermaßen stille halten und über lange, lange Tage mit ihren Rettern zusammenwirken. Das hatten die Psychologen vorher kaum für möglich gehalten.
Von dem Komponisten unseres Liedes Severus Gastorius lesen wir im Heft zu diesem Gottesdienst eine ähnlich anrührende Geschichte: Sein Freund Samuel Rodigast hatte ihm dieses Gedicht zum Trost geschrieben, als er sterbenskrank zu Hause lag. Die Kräfte des Kantors reichten immerhin noch, um eine Melodie zu notieren. Und er bestimmte, dies Lied solle bei seiner Beerdigung gesungen werden. Doch wider Erwarten kam er wieder zu Kräften. Seitdem ließ er den Choral allwöchentlich vor seinem Hause singen. Dass er herzhaft in ihn eingestimmt, ja ihn angestimmt hat, dürfen wir als sicher annehmen. So weit, so schön.
Doch ein weiterer Blick in seine Biographie lehrt uns: Gastorius entging zwar mit 29 dem Tod. Aber sein Leben währte insgesamt nur 36 Lebens-
und 11 Ehejahre. Er hinterließ damals eine 27jährige Witwe, die ihm sieben Kinder geboren hatte. Fünf von ihnen waren am Leben geblieben.
Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille? Wer von uns würde es wagen, einer so geschlagenen Frau diese Zeilen als Trost zuzusprechen?
Oder den Angehörigen der 37 Kumpel, die in den letzten Tagen in China nicht gerettet werden konnten. Uns würde doch das Wort im Munde stecken bleiben – bei dem Elend, das sich hier andeutet!
Und das bleibt ja wahr: Es gibt Situationen, in denen die Rettung ausbleibt,
in denen die Gesundung nicht mehr möglich ist, in denen der Arbeitsplatz unwiederbringlich verloren geht. Da wäre es einfach unbarmherzig, die Wut, die Trauer, die erste Trostlosigkeit zuzudecken und die Leidenden nicht ernst zu nehmen.
Als Hiob im Unglück saß, so berichtet die Bibel, kamen seine Freunde, saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm; denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Sie haben ihren Freund und seinen Verlust ernst genommen, ehe sie sich dann zu ihren Gesprächen vortasteten, ihren Streit begannen – mit starken Worten –
und ihre Antworten suchten.
Manche davon ähnelten durchaus unserem Choral:
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille.
Aber Samuel Rodigast hat seinem Freund nicht nur diese erste Strophe geschenkt. Johann Sebastian Bach hat sich in der Kantate nicht nur mit diesem ersten Vers begnügt. Das Lied kennt die raue Bahn – Not, Tod und Elend. Und Bach lässt singen:
Ach Gott! wenn wirst du mich einmal
Von meiner Leidensqual,
Von meiner Angst befreien?
Wie lange soll ich Tag und Nacht
Um Hilfe schreien?
Im Evangelium: Ein Vater schreit Jesus an – um Hilfe. Der geht überhaupt nicht auf ihn ein. Jesus unterstellt ihm einen Glauben, der Wunder und Zeichen braucht. Er stellt die rhetorische Frage: Darf man das Gottvertrauen so an Bedingungen binden? Die Antwort liegt auf der Hand: Gewiss nicht!
Doch da geschieht das eigentlich Unerwartete. Der Mann wehrt sich nicht gegen den Verdacht, die Unterstellung. Er verteidigt sich nicht. Aber er wiederholt seine dringende Bitte: Komm, ehe mein Kind stirbt! Ich möchte so hartnäckig sein können! Ich möchte so glauben können ohne Garantien, ohne Bedingungen, aber offen für Wunder. Ich möchte Augen und Ohren haben, die Zeichen aufnehmen, heute und morgen. Ich möchte ein Herz haben, das dann auch noch das größte Wunder erwarten kann, das Wunder, das die Grenzen meines Lebens überschreitet.
Jesusgeschichte und Kirchenmusik blicken weit über die gegenwärtige Not hinaus. Sie formulieren ihr ein Vertrauen für das ganze Leben und doch weit darüber hinaus. Am Ende der rauen Bahn, von Not, Tod und Elend, so dichtete es Rodigast und so werden wir es singen: wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten; drum lass ich ihn nur walten. Und auch am Ende der Kantate wird der Bass für jeden Glaubenden bekennen:
Meinen Jesum lass ich nicht,
Bis mich erst sein Angesicht
Wird erhören oder segnen.
In diesem „oder segnen“ liegt der eigentliche Zielpunkt des Zutrauens. Denn es meint den Segen, der Anfang und Ende unseres Lebens umfasst, weit über das Sterben hinausgeht; den Segen, der uns in der Krankheit, in der schlimmen Not immer noch Hoffnung gegen allen Augenschein behalten lässt: Auf die Hand, in die wir fallen, auf das Gesicht, das uns begrüßen wird, wenn wir selber alles, auch uns selbst verloren haben. Das ist ein fester Stab in der Hand auf ungebahnten Wegen, wenn wir nicht wissen, wie es mit unseren Kindern weitergeht. Es ist ein Geländer, wenn uns die Knie weich werden und uns das eigene Leben mehr Mühe als Freude bereitet. Ärzte und Seelsorgerinnen berichten, wie verschieden Menschen die gleiche Krankheit und die gleiche unsichere Aussicht auf Heilung aufnehmen; gefasst oder unsicher, getrost oder verzweifelt.
Ich wünsche uns allen den Glauben, zu dem der Vater im Evangelium gefunden hatte, ein Gottvertrauen, das sich gerade in der Unsicherheit bewährt und erst im Nachhinein bestätigt wird. Denn unser Leben wie unser Glaube wird nach vorn gelebt und erst rückwärts verstanden.
Darum bitten wir Gott um seinen Frieden, der unsere Sorgen und Ängste umschließt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen