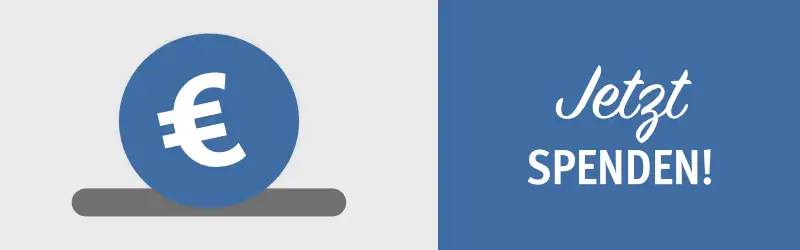16.10.2010
Predigt von Professor Dr. Peter Maser am 10. Oktober 2010 in der Georgenkirche
über Epheser 4,22-32
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
in diesen Tagen wird auf vielfache Weise der deutschen Wiedervereinigung vor zwanzig Jahren gedacht. Viele von Ihnen werden hier ihre ganz persönlichen Erinnerungen einbringen können. Ich erlebte den 3. Oktober 1990 in Wien, wo ich zu einem internationalen Symposium über die spätantike jüdische Malerei eingeladen war. Das sehr spezielle Thema brachte es fast zwangsläufig mit sich, daß bis auf einen Kollegen aus Jena und mich alle damals vor allem aus den USA und Israel in Wien versammelten Wissenschaftler jüdischer Herkunft waren. Mich bewegte in diesem Umfeld die quälende Frage: Darf ich mich in diesem Kreis und in dem Wissen um die jüngste deutsche Geschichte wirklich über die deutsche Wiedervereinigung freuen? In den Pausen zwischen den Referaten und Diskussionen wurde damals über alles geredet, nur nicht über das, was da am 3. Oktober in Berlin Wirklichkeit werden sollte. Am Nachmittag vor dem großen Tag überbrachte mir dann der Leiter des Symposiums im Auftrag des Rektors der Universiät Wien eine sehr diskrete Einladung zu einem festlichen Essen in einem noblen Heurigenlokal weit außerhalb der Stadt: „Wir wollen Ihnen, die Sie aus Deutschland gekommen sind, doch zu ihrem großen Tag von Herzen gratulieren, wir können es aber nicht in diesem Kreis tun.“ Mein Kollege aus Jena und ich haben das in jeder Weise verstanden und den Abend zusammen mit dem charmanten Prorektor der Universität im kleinsten Kreise genossen - die Gedanken immer in Deutschland. Als wir zur nächtlichen Stunde in die Wiener Innenstadt zurückfuhren, flammten über die ganze Fassade des Rathauses die Worte „Wien gratuliert Deutschland“. Das hat uns sehr berührt, zugleich aber dachten wir beklommen an den kommenden Morgen, wo wir unseren jüdischen Kolleginnen und Kollegen gegenübertreten mußten. Und dann ereignete sich mein ganz persönliches Wiedervereinigungswunder! Als wir den Hörsaal betraten, waren alle unsere Kollegen bereits versammelt und die attraktivste Kollegin aus den USA war hinter einem großen Blumenstrauß kaum noch zu sehen: „Wir alle wissen, was für ein großes Ereignis Ihr Land und Sie ganz persönlich jetzt erleben. Und wir alle wollen Ihnen nun mit diesen Blumen unsere aufrichtigsten, kollegialen Glückwünsche zur deutschen Wiedervereinigung sagen.“ Da erst haben wir uns damals ganz aus der Tiefe unserer Herzen freuen und das Geschenk den Wiedervereinigung auch innerlich wirklich annehmen können.
Lang, lang ist das alles her - vielleicht zu lange. Ich stelle mir vor, ich hätte damals vor zwanzig Jahren unseren heutigen Predigttext auszulegen gehabt. Ach, wie leicht, ja fast selbstverständlich hätten damals die apostolischen Weisungen in unseren Ohren geklungen. Ich bringe nur einige davon noch einmal in Erinnerung: „Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel! Erneuert euch in eurem Geist und Sinn! Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit! Arbeitet und schafft, damit ihr den Bedürftigen abgeben könnt! Redet, was gut ist und was aufbaut! Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern euch samt aller Bosheit! Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern!“
In der Euphorie der damaligen Tagen hätten wir uns die Befolgung solcher Weisungen doch wirklich zugetraut. Noch lagen wir ja einander in den Armen. Noch hatten wir das „Seid umschlungen Millionen!“ aus Schillers „Ode an die Freude“ auf den Lippen. Noch sahen wir die „blühenden Landschaften“ schon unmittelbar vor uns. Noch glaubten nicht wenige, nun könnten Bundeswehr und NVA zusammen ihre Fahnen einrollen, da das Reich des ewigen Friedens demnächst Wirklichkeit werden müßte. Noch glaubten wir, das jener Zustand, den die Volksmassen so unmittelbar treffend immer wieder mit „Wahnsinn!“ umschrieben hatten, niemals enden würde.
Lang, lang ist das alles her! Wir sind inzwischen schon längst wieder auf dem harten Boden der Realitäten angekommen, haben viele Enttäuschungen durch andere und durch uns selber registrieren müssen und haben nicht nur die Mühsale der Ebenen ganz allgemein, sondern auch die Mühen der Erinnerung durchkostet. Die Bürgerrechtler von damals sind inzwischen fast alle im Rentenalter angekommen, manche von ihnen haben inzwischen resigniert, viele sind verbittert und zu viele von ihnen untereinander zerstritten. An zahlreichen Orten in unserem wiedervereinigten Land haben wieder oder noch immer die Falschen das Sagen. Die Bundeswehr verteidigt jetzt die Freiheit am Hindukusch. Die heute am häufigsten zu hörenden Begriffe lauten „Finanzkrise“, „Hartz IV“ und „Sparzwänge“. Thilo Sarrazins nachtschwarzer Traktat „Deutschland schaft sich ab“ wurde in mehr als 1 Million Exemplaren verkauft. Unsere Kirchen haben sich wieder kräftig geleert! Die Erinnerung an die spannungsvolle Überfüllung der Friedensandachten verblaßt immer mehr. Bei den Gottesdiensten in meinen Dörfern muß ich mich oft genug mit dem Jesuswort von den zwei oder drei trösten, bei denen der Herr sein will. Ob die weiträumige Zusammenlegung von Gemeinden und ganzen Landeskirchen wirklich der wahre Heilsweg ist, frage wahrscheinlich nicht nur ich mich.
Aber Halt! Natürlich könnte ich nun auch Stück für Stück die komplette Gegengeschichte zu diesem großen Klagesang erzählen. Das will ich hier aber nicht tun, sondern lieber zu unserem Predigttext aus dem Epheserbrief zurückkehren, auf den sich ja auch die kraus-barocke Dichtung der soeben musizierten Telemann-Kantate „Es ist ein schlechter Ruhm“ bezieht. Als ich ihnen vorhin eine Auswahl der dort so geballt daher kommenden Weisungen in Erinnerung gerufen habe, habe ich ja nicht vollständig zitiert. Der Prediger, der seinen Brief im Geist des Apostel Paulus verfaßte, wußte ja bereits auch so viel von der „Unsicherheit menschlicher Verhältnisse“ wie der Dichter Bertolt Brecht, der in seinem ersten Dreigroschenfinale kurz und flott reimte: „Wir wären gerne gut anstatt so roh, doch die Verhältnisse, die sind nicht so.“ Der unbekannte Paulusschüler, der da seinen Brief nach Ephesus richtete, kannte die „menschlichen Verhältnisse“, er kannte die unbarmherzigen Regeln, nach denen das menschliche Zusammenleben so abgewickelt wird. Aber er wußte auch von einer Realität, in der die Verhältnisse ganz anders sein können. Seine Ausdrucksweise ist bildhaft-poetisch, aber vielleicht gerade deshalb so eindrücklich: „Zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit! Betrübt doch nicht den heiligen Geist, der euch gegeben ist bis zu dem Tag der Erlösung!“ Und dann noch dieses ganz wichtige Wort: „Vergebt einander, wie euch Gott vergeben hat in Christus!“
Hier gibt sich einer nicht zufrieden mit dem Verweis auf die immer gleichbleibende Miserabilität der menschlichen Verhältnisse. Hier weiß einer: Da steht noch ein andere Weg offen! Der „neue Mensch“ ist möglich! Jener „neue Mensch“, von dessen prinzipiellen Möglichkeiten wir in den Hochphasen unserer Begeisterung etwas erahnten, um dann so erschreckend schnell wieder auf die alten Wege zurückzukehren, als die „Mühen der Ebene“ spürbar wurden. Wir haben diese Erfahrungen gemacht, und manche sind darüber bitter geworden. Auch schon in Ephesus hatte man das erleben müssen: Die Begeisterung der Neubekehrten wurde nur allzu oft schnell brüchig, wenn es zur Konfrontation mit den Verhältnissen kam, die eben nicht so sind.
Gegen solchen Realitätsschock ruft der Prediger des Epheserbriefs drei Sachverhalte in Erinnerung, die auch für uns mit unseren Enttäuschungen, unserer Müdigkeit, unseren Ängsten, unserem Zorn und manchmal auch unserer Verzweiflung so grundlegend wichtig sind: 1. Erneuerung ist jeden Tag nötig. In der Telemann-Kantate wurde das recht poetisch formuliert: „Erneure dich an Geist und Herzen, sonst gleichst du nur gemalten Kerzen, bei welchen Glanz und Glut gebricht.“ Erneuerung ist aber nicht nur nötig, sondern auch möglich. Der „neue Mensch“, der „nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“, dieser neue Mensch ist nicht ein für allemal fertig, sondern er muß immer neu werden. Wo wir merken, wie schwer es uns mit dem „neuen Menschen“ fällt, ist nun aber nicht Verzweiflung angesagt, sondern ständiger Neubeginn, vielleicht mal mehr, vielleicht mal auch weniger, aber immer vorwärts. 2. Wir leben noch immer hin auf den großen Tag der Erlösung. Dann erst werden wir „neue Menschen“ in Vollkommenheit sein. Dann erst wird es keine Rückschläge, keine Verzweiflung, keine Angst, keine Müdigkeit, keinen Zorn mehr geben. Wir warten auf diesen Tag der Erlösung in aller „Unsicherheit menschlicher Verhältnisse“ in dem Wissen, daß erst dieser große Tag der Erlösung das in Herrlichkeit vollenden wird, was am Karfreitag auf Golgatha begonnen wurde. 3. Wir dürfen in der Vergebung leben, weil Gott uns in Christus vergeben hat, weil Gott Ja zu uns sagt - trotz aller unserer Verzweifung, trotz allem Versagen, trotz aller Müdigkeit. Wir dürfen und können einander vergeben und - das scheint mir heute besonders wichtig - wir dürfen und wir können auch uns selber vergeben. Vergebung meint ja nicht dieses gedankenlose „Schwamm drüber“, sondern die Freigabe für die Erneuerung hin zu dem, wozu uns Gott bestimmt hat - zu dem neuen Menschen, „der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“.
Dieser Gottesdienst ist Teil einer Reihe der sog. „Lutherdekade“, die 2017 ihren Zielpunkt, das 500-Jahr-Gedenken an die von Martin Luther ausgelöste Reformation, erreichen soll. Heute habe ich hier besonders an den großen Aufbruch des wiedervereinigten Deutschland erinnert. Die Reformation war auch ein solcher großer Aufbruch, in dem so vieles an neuer Erkenntnis, an neuen Möglichkeiten in Kirche und Gesellschaft, an Gestaltung eines „neuen Menschen“, an Begeisterung für das Evangelium zusammenkam. Martin Luther selber hat diesen Aufbruch zu einer umfassenden Erneuerung der Kirche und der Welt mit aller Leidenschaft auf den Weg gebracht, mitgestaltet und miterlebt. An seinem Lebensende konnte er sich sicher sein, daß trotz aller Widerstände und Enttäuschungen, auch im eigenen Lager, die Entwicklung unumkehrbar gemacht worden war. Und trotzdem notierte dieser große Christ ganz zuletzt auf einem Zettel die Worte: „Wir sind Bettler. Hoc est verum. Das ist wahr.“ Ich habe über diese letzte Notiz Luthers oft nachgedacht. Ist sie etwa das in der Stunde letzter Ehrlichkeit formulierte Eingeständnis des Versagens, der Nutzlosigkeit und einer ganz großen Verzweiflung? Ich glaube das nicht. In gerade zu dramatischer Verkürzung brachte der große Reformator hier noch einmal die Erkenntnis auf den Punkt, daß auch der, der Geschichte wie wenige andere bewegt hat, die Erneuerung in Gerechtigkeit und Wahrheit nur als Geschenk Gottes erfahren darf, daß der Tag der Erlösung noch aussteht, aber mit unwandelbarer Sicherheit kommt, daß wir alle aus der Vergebung und nur daraus leben und deshalb Bettler sind und bleiben vor dem, der uns zu „neuen Menschen“ berufen hat.
Auch die Reformation hat die „Mühen der Ebenen“ und die „Unsicherheit menschlicher Verhältnisse“ auskosten müssen. Die Kirchengeschichte weiß davon eine Menge zu erzählen, aber sie kann auch davon berichten, wie Gott immer wieder und gerade dann, wenn es besonders schwierig voranging, Menschen dazu befähigte, als „neue Menschen“ in Kirche und Gesellschaft zum Aufbruch zu neuen Ufern und auf neuen Wegen zu rufen. Wir können das nicht herbeizwingen, aber wir können dafür immer wieder beten, gerade auch in Zeiten, in denen unser Erinnern an die großen Aufbrüche so matt, so mühsam, so pflichtgemäß, so schwächlich daher kommt. Wir können uns selber auf neue Wege wagen und in aller Unvollkomenheit versuchen, neue Menschen zu werden. Wir werden dabei immer Bettler bleiben, die Gott bitten, ja anbetteln, daß er uns zu neuen Menschen werden läßt in der Kraft seines Geistes. Aber bitten dürfen und müssen wir darum! Wir tun damit der Kirche und der Gesellschaft einen unverzichtbaren Dienst!
Und der Friede Gottes, welcher höher ist alle Vernunft, der bleibe bei uns bis zu dem Tag unserer vollkommenen Erlösung. Amen.